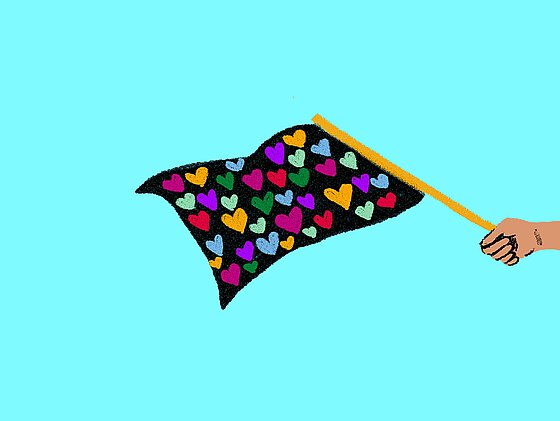Comingout als nicht-heterosexuell

Als Comingout (engl. „come out“: herauskommen) wird der Prozess bezeichnet, die eigene Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung oder Lebensweise öffentlich zu machen, obwohl sie von herrschenden Normen abweicht.
Dabei wird mitunter zwischen einem inneren und äußeren Comingout unterschieden: Beim inneren Comingout wird sich jemand der eigenen geschlechtlichen Identität oder sexuellen Orientierung bewusst; das äußere Comingout beschreibt dann das selbstbestimmte „Öffentlichmachen“ zum Beispiel am Arbeitsplatz oder in der Familie.
Zeitpunkt und Art des Comingouts sind grundsätzlich individuell und können in jedem Lebensalter erfolgen; oftmals geschieht dieser Schritt jedoch bereits im Jugendalter.
Das Comingout bei Jugendlichen
Das Deutsche Jugendinstitut veröffentlichte 2015 eine durch das Bundesfamilienministerium geförderte Studie zum Thema Comingout, an der sich über 5.000 Jugendliche in Deutschland beteiligten. Hierbei zeigte sich, dass sich die Mehrheit der nicht-heterosexuellen Jugendlichen im Alter zwischen 13 und 16 Jahren ihrer sexuellen Orientierung bewusstwurde.
Den Weg bis zu diesem ersten, inneren Comingout und die damit verbundene Sorge um mögliche Folgen empfanden die meisten Befragten als deutlich belastend. Dreiviertel der Jugendlichen befürchteten Ablehnung durch Freund*innen, fast ebenso viele Ablehnung durch Familienangehörige. Informationen und der Austausch mit anderen queeren Menschen im Internet spielten für sie eine große Rolle bei der Bewältigung dieses oft langwierigen Prozesses.
Bei ihrem ersten äußeren Comingout, meist im Freund*innenkreis, waren die nicht-heterosexuellen Jugendlichen dann im Durchschnitt 16,9 Jahre alt; es liegen demnach bisweilen mehrere Jahre zwischen dem inneren und dem äußeren Comingout.1
Tipps und Informationen rund um das Erkennen der eigenen sexuellen Orientierung und das Comingout im Jugendalter bietet die Broschüre „Sexuelle Vielfalt und Coming-out. Ein Ratgeber für Jugendliche“ der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
Das Comingout in späteren Lebensphasen
Obgleich das Durchschnittsalter für das Comingout sinkt, gibt es Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen für ein spätes äußeres Comingout entscheiden, beispielsweise nach einer Familiengründung oder im Ruhestand.
Gesellschaftliche Konventionen haben es heutigen lsb Senior*innen schwer gemacht, ihre sexuelle Orientierung offen zu leben. Mehr als zwei Jahrzehnte hielt die Bundesrepublik an den Fassungen der Paragraphen 175 und 175a aus der Zeit des Nationalsozialismus fest, wonach sexuelle Handlungen zwischen erwachsenen Männern unter Strafe standen. 1969 kam es zu einer ersten, 1973 zu einer zweiten Reform. Seitdem waren sexuelle Handlungen Erwachsener mit männlichen Jugendlichen unter 18 Jahren strafbar, während ansonsten die Schutzaltersgrenze bei 14 Jahren lag. Erst nach der Wiedervereinigung – im Jahr 1994 – wurde der Paragraph 175 auch für das Gebiet der alten Bundesrepublik ersatzlos aufgehoben.
Die HIV-Krise sorgte ab den 1980er-Jahren für eine zusätzliche Stigmatisierung insbesondere schwuler und bisexueller Männer.
Für Frauen und speziell Mütter wiederum war es aufgrund der herrschenden normativen Rollenbilder schwer, eine nicht-heterosexuelle Identität zu entwickeln und offen zu leben.
Gerade Menschen, die in einer heterosexuellen Beziehung eine Familie gegründet haben und sich in einer späteren Lebensphase als nicht-heterosexuell outen, sehen sich mitunter mit zusätzlichen Sorgen und Konflikten konfrontiert. Das Comingout kann für den oder die langjährige*n Partner*in sowie beteiligte Kinder schmerzhaft sein und den weiteren gegenseitigen Umgang beeinflussen.
Der Lesben- und Schwulenverband (LSVD) hat auf seiner Website Erfahrungsberichte und Tipps zum Thema „Spätes Comingout“ zusammengestellt.
Das Comingout am Arbeitsplatz
Neben dem Outing im privaten Umfeld stellt sich für Beschäftigte die Frage, wie offen sie mit ihrer sexuellen Orientierung am Arbeitsplatz umgehen möchten. Die Studie „Out im Office?!“, an der 2017 fast 3.000 lsbt* Personen in Deutschland teilnahmen, zeigt, dass sich etwa jede dritte schwule oder lesbische Person in diesem Kontext nicht outet; bei bisexuellen Beschäftigten ist es sogar mehr als die Hälfte. Dies steht möglicherweise im Zusammenhang mit vorangegangenen negativen Erlebnissen: Ungefähr drei Viertel der lesbischen und schwulen Teilnehmenden berichteten von Diskriminierungserfahrungen; bei den bisexuellen Befragten betrug die Quote 95,5 Prozent.2 Im Extremfall können Nachteile vom Mobbing am Arbeitsplatz bis hin zur Kündigung entstehen.
Dabei profitiert von einem Comingout auch der Arbeitgeber, denn die Möglichkeit, sich offen zu zeigen, steigert laut der Studie die Arbeitszufriedenheit und die Unternehmensverbundenheit der lsbtiq* Beschäftigten.
Auch Befürchtungen, die den persönlichen Kontakt zwischen nicht-heterosexuellen Mitarbeitenden und Kund*innen betreffen, sind laut einer weiteren Studie im Wesentlichen unbegründet. So fiel die Akzeptanz der Kund*innen gegenüber den geouteten Befragten aus ihrer Perspektive deutlich positiver aus als von diesen antizipiert.3
Tipps rund um das Comingout am Arbeitsplatz bietet die Broschüre LGBT*IQ Für Arbeitnehmer_innen: LGBTI*IQ – und du? Coming out für Insider von Prout at Work.
Gründe für ein Comingout – und Gründe dagegen
Die im Rahmen der eingangs erwähnten Studie befragten Jugendlichen begründeten ihr äußeres Comingout häufig damit, sich mit anderen über die eigenen Gefühle austauschen zu wollen und sich nicht länger verstecken oder verstellen zu müssen.4 Die meisten von ihnen outeten sich zunächst in ihrem Freund*innenkreis – und bewerteten die Reaktionen überwiegend als sehr gut beziehungsweise gut. Dieses Ergebnis steht im deutlichen Kontrast zu den starken Befürchtungen und Bedenken, die viele von ihnen im Vorfeld des Comingouts hatten.
Das offene Ausleben der sexuellen Orientierung kann also ein höheres Gefühl der Authentizität in zwischenmenschlichen Beziehungen bewirken – das dauerhafte Verbergen andererseits zu einem erhöhten Stressniveau führen. Auch körperliche Folgen können sich bemerkbar machen: Die Ergebnisse der Studie „Out im Office?!“ weisen auf einen direkten Zusammenhang zwischen psychosomatischen Beschwerden und dem Verbergen der eigenen sexuellen Orientierung hin.5
Weitere individuelle Motive für ein Comingout können zum Beispiel Empowerment und eine erhöhte Sichtbarkeit von LSBTIQ* bis hin zum Comingout als politisches Statement sein.
Gründe, die gegen ein Comingout sprechen, sollten nichtsdestoweniger ebenso bedacht werden. Hollywood-Produktionen zeigen häufig in stereotyper Weise, dass für queere Protagonist*innen ein Comingout als Happyend und Auflösung aller Probleme am Ende eines Prozesses voller Verwirrung steht. Problematisch wird dies, wenn auch innerhalb der lsbtiq* Community ein Comingout implizit als selbstverständlicher Prozess verstanden wird, auf den es hinzuarbeiten gälte,6 oder es gar zu „gut gemeinten“ Zwangsoutings kommt.
Zu den Aspekten, die ein Comingout verhindern können, gehört die Befürchtung negativer Reaktionen innerhalb der Familie, gegebenenfalls der religiösen Gemeinde oder des gesellschaftlichen und politischen Umfelds vor Ort.
Daneben können unter Umständen gesellschaftliche Nachteile entstehen, die von Diskriminierung und Stigmatisierung bis zur Gefährdung der eigenen Sicherheit reichen. Dies ist insbesondere in jenen Ländern der Fall, in denen LSBTIQ* politisch verfolgt werden; aber auch in Deutschland ist in Gegenwart und jüngerer Vergangenheit eine besorgniserregende Zunahme von Diskriminierung und queerfeindlichen Hasstaten zu verzeichnen.
Bei erlebten Benachteiligungen, Beschimpfungen oder tätlichen Angriffen können rechtliche Schritte eingeleitet werden. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz verbietet vor allem im arbeitsrechtlichen Kontext Benachteiligungen aufgrund der sexuellen Identität. Informationen und Beratung hierzu bietet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes.
Vielen Menschen bleibt zudem aufgrund von weiteren wichtigen alltäglichen Herausforderungen und Sorgen kein Raum, sich überhaupt mit ihrer sexuellen Orientierung beziehungsweise geschlechtlichen Identität auseinanderzusetzen, passende Begriffe dafür zu finden und sich Communitys anzuschließen. Gründe dafür können sein, dass sie mit Beeinträchtigungen leben, eine (familiäre) Flucht- oder andere Migrationsgeschichte haben oder andere Umstände für sie eine bestimmende Rolle spielen, etwa die regionale Herkunft, eine chronische Krankheit, die finanzielle Situation, Wohnungslosigkeit oder ein allein zu erziehendes Kind. Viele dieser Aspekte bringen (gravierende) andere, zusätzliche, sich gegenseitig verstärkende Belastungen und Diskriminierungsrisiken mit sich.
Darüber hinaus gibt es Menschen, die LSBTIQ*-Identitätskategorien als nicht passend oder zu limitierend für sich empfinden.
Ob sich ein nicht-heterosexueller Mensch outet oder nicht, wem gegenüber und in welchem Kontext und wann der dafür passende Zeitpunkt gekommen ist, ist eine höchstpersönliche Entscheidung – und weist doch weit darüber hinaus, denn sie hat unmittelbar Einfluss auf die gesellschaftlichen Verhältnisse.
In jedem Fall gilt: Es braucht nicht unbedingt ein Comingout, um zur LSBTIQ*-Community zu gehören – oder um ihre Angebote zu nutzen.
Zum Weiterlesen und Vernetzen
Für Menschen, die über ein Comingout nachdenken, kann es hilfreich sein, in Autobiografien, Interviews oder ähnlichen Erfahrungsberichten davon zu erfahren, wie andere ihr Comingout erlebt und gestaltet haben.
Empfehlenswert ist auch ein persönlicher Austausch mit anderen Personen, zum Beispiel in Foren, Selbsthilfegruppen oder bei einer Beratungsstelle.
1 Krell, Claudia/Oldemeier, Kerstin (2015): Coming-out – und dann...?! Ein DJI-Forschungsprojekt zur Lebenssituation von lesbischen, schwulen, bisexuellen und trans* Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Deutsches Jugendinstitut, vgl. S. 12-15. Zuletzt abgerufen am 09.08.2023 von www.dji.de/fileadmin/user_upload/bibs2015/DJI_Broschuere_ComingOut.pdf. (Anm. der Red.: Obgleich die Studie etwas älter ist, hat die Redaktion sich entschieden, sie aufzunehmen, da zwischenzeitlich keine ähnlich fundierte Befragung Jugendlicher zu diesem Thema in Deutschland durchgeführt wurde.)
2 Frohn, Dominic et. al (2017), Executive Summary: Out im Office?! Sexuelle Identität, (Anti-)Diskriminierung und Diversity am Arbeitsplatz. IDA | Institut für Diversity- & Antidiskriminierungsforschung, vgl. S. 5 f.. Zuletzt aufgerufen am 18.08.2023 von www.proutatwork.de/angebot/out-im-office/.
3 Frohn, Dominic et. al (2021), Out im Office! Out vor Kunden_innen? Die Arbeitssituation von LSBT*I*Q+ Personen im Kunden_innen-Kontakt. | Institut für Diversity- & Antidiskriminierungsforschung, vgl. S. 9. Zuletzt aufgerufen am 30.08.2023 von www.diversity-institut.info/wp-content/uploads/2022/11/IDA_2021_Kunden_innen_2021_05_01.pdf.
4 Vgl. Krell/Oldemeier (2015), S. 16.
5 Vgl. Frohn (2017), vgl. S. 8.
6 Timmermanns, Stefan et. al (2021): „Wie geht’s euch?“ Psychosoziale Gesundheit und Wohlbefinden von LSBTIQ*. Beltz Juventa, vgl., S. 34.